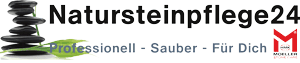Flechten auf Steinen: Entstehung und Entfernung
Flechten auf Naturstein – Ursachen, Entfernung und nachhaltiger Schutz
Flechten sind komplexe Lebensgemeinschaften aus Pilzen und Algen (oder Cyanobakterien). Sie bilden eine Symbiose, in der der Pilz Struktur und Schutz liefert, während die Alge Photosynthese betreibt. Diese Kombination macht Flechten extrem widerstandsfähig – sie überstehen Frost, Trockenheit und UV-Strahlung und wachsen sogar auf kargen Gesteinsflächen.
Auf Naturstein haften sie fest und dringen mit feinen Pilzfäden in die Porenstruktur ein. Gleichzeitig scheiden sie organische Säuren aus, die langfristig zu einer chemischen und biologischen Verwitterung des Steins beitragen. Je dunkler und kompakter die Flechte, desto schwieriger ist ihre Entfernung.
Wie Flechten auf Steinoberflächen entstehen
Flechten benötigen kaum Nährstoffe. Sie beziehen Mineralien aus Regenwasser, Staub und Luft, während die Algenanteile durch Photosynthese Energie gewinnen. Sie siedeln bevorzugt an feuchten, schattigen und schlecht belüfteten Orten – etwa auf Terrassen, Mauern, Pflaster oder Denkmälern. Besonders anfällig sind offenporige, raue Steine wie Sandstein oder unpolierte Granite.
Wiederkehrende Feuchtigkeit, stehendes Wasser und organische Ablagerungen (z. B. Laub, Erde) begünstigen das Wachstum zusätzlich. In ländlichen Regionen oder in der Nähe von Bäumen ist die Flechtenbildung naturgemäß stärker.
Flechten von Naturstein entfernen
Da Flechten sowohl oberflächlich als auch tief in der Porenstruktur verwachsen, ist eine Kombination aus mechanischer und chemischer Reinigung erforderlich. Geduld und sorgfältiges Arbeiten sind entscheidend, um den Stein nicht zu beschädigen.
1. Mechanische Entfernung
Lose oder oberflächliche Beläge lassen sich mit einer harten Nylonbürste oder einem Schrubber abtragen. Die Fläche sollte vorher angefeuchtet werden, um das Ablösen zu erleichtern. In kreisenden Bewegungen arbeiten und anschließend gründlich mit Wasser nachspülen, damit Sporenreste und Säurerückstände entfernt werden. So wird ein erneutes Anwachsen deutlich erschwert.
2. Chemische Behandlung
- HMK® R160 Schimmel-EX: Bleicht und zerstört die organischen Pigmente der Flechten. Für nachhaltige Wirkung mindestens 1 Stunde Nasshaltezeit, bei starkem Befall länger. Feucht halten, um die Aktivität aufrechtzuerhalten.
- Tipp: Ein feuchtes Tuch oder Zellstoff mit HMK® R160 tränken, auflegen und mit Folie abdecken – so kann der Wirkstoff tiefer in die Flechtenstruktur eindringen.
- HMK® R170 Außenreiniger: Zur großflächigen Behandlung von Algen-, Moos- und Flechtenbewuchs im Außenbereich.
- HMK® R155 Grundreiniger (säurefrei): Nachreinigung, um gelöste Rückstände vollständig zu entfernen und die Oberfläche zu neutralisieren.
3. Hochdruckreiniger – mit Vorsicht
Hochdruckgeräte können Flechten zwar scheinbar vollständig entfernen, wirken jedoch nur oberflächlich. Die feinen Pilzfäden (Hyphen) der Flechten dringen tief in die Porenstruktur ein und bleiben dort meist erhalten – der Bewuchs kehrt daher nach kurzer Zeit zurück.
Hinzu kommt: Auf weichen Steinen wie Kalkstein oder Sandstein wird die Oberfläche durch den Druck aufgeraut, wodurch neue Angriffsflächen entstehen. Aber auch bei harten Gesteinen wie Granit erhöht zu hoher Druck die Porosität und begünstigt zukünftigen Algen- und Flechtenbefall. Wenn Hochdruck unvermeidbar ist, sollte er nur mit Flächenreinigeraufsatz und reduziertem Druck eingesetzt werden – stets in Kombination mit einer anschließenden chemischen Behandlung.
4. Vorbeugung gegen Neubefall
- Standort und Belüftung: Möglichst sonnige, gut belüftete Flächen schaffen – Staunässe und Schatten vermeiden.
- Imprägnierung: Eine diffusionsoffene Imprägnierung, z. B. HMK® S234 Fleckschutz Top-Effekt, reduziert die Wasseraufnahme und erschwert das Ansiedeln von Mikroorganismen.
- Regelmäßige Pflege: Wiederkehrende Reinigung mit HMK® R155 entfernt Nährschichten und hält die Oberfläche gleichmäßig trocken. Bei Bedarf kann HMK® R170 vorbeugend eingesetzt werden.
Fazit
Flechten sind ein natürlicher, aber unerwünschter Bewuchs auf Naturstein. Durch Kombination aus mechanischer und chemischer Reinigung sowie anschließender Imprägnierung lassen sie sich wirkungsvoll beseitigen. Wer auf regelmäßige Pflege und gute Belüftung achtet, kann den Neubefall langfristig minimieren und die natürliche Schönheit des Steins erhalten.